
Veröffentlichungen von Urmila Goel
Fremdes vertrautes Indien
Ein (Dienst-)Reisebericht
erschienen in:
Meine Welt 19/1, 19-20.
(Text als pdf)
Sieben Jahre waren vergangen. Sieben Jahre in denen viel passiert war. Das VWL-Studium war abgeschlossen und auch das neu aufgenommene Studium der Südasienkunde. Ein Jahr hatte ich in London verbracht, mich intensivst mit Südasien auseinandergesetzt. Ich las regelmäßig indische Zeitschriften. Nur den Hindi-Kurs hatte ich auslaufen lassen. Die Grammatik hatte mich in die Schranken gewiesen. Und all die Jahre war ich nicht wieder nach Indien gefahren. Keine Zeit, kein Geld.
Indien betrachtete ich aus der Ferne. Indern in Deutschland galt mein Hauptaugenmerk. Und dann – ich war mittlerweile Südasien-Referentin einer politischen Stiftung geworden – stand eine Dienstreise auf den Subkontinent an. Auf einem regionalen Treffen sollte ich die Kollegen vor Ort kennenlernen und mit ihnen die Schwerpunkte der Arbeit diskutieren. Tagungsort war Islamabad, Pakistan. Eine Gelegenheit auf Vertrautes und Neues zu treffen. Die Politik aber machte einen Strich durch die Rechnung. Indien rüstete gegen Pakistan auf, verbal und militärisch. Die Tagung wurde verschoben. Ich blieb in Bonn.
Besprechen aber mussten wir uns weiterhin. Nach Pakistan konnten die Inder nicht reisen. Kathmandu war im Ausnahmezustand. Colombo gerade friedlicher, aber auch ein ganzes Stück Weg für die Kollegen. Und so war nun Delhi der Ort, an dem wir uns treffen würden. Ich würde nach Indien reisen zu einer Besprechung. Ich, die es jahrelang nicht geschafft -oder gewollt - hatte, mir Zeit für eine Reise zu nehmen.
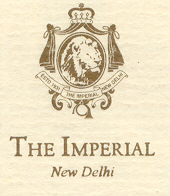 Aber fuhr ich wirklich nach Indien? Als mich der Kollege nachts in das
Hotel brachte, fragte ich mich das ernsthaft. Es war auf jeden Fall nicht das Indien, das ich von meiner Familie her kannte. Dafür ist das Imperial viel zu sauber, funktionstüchtig und wahrlich „imperial“. An allen Wänden hängen britische Lithografien mit heldenhaften Soldaten und exotischen Eingeborenen. Die Kellner tragen Fantasieuniformen. Das Frühstücksbuffet bietet English Breakfast mit allem drum und dran und auch ein paar kalte Paranthas und Pickles. Schwarzer Tee wird ständig nachgeschenkt, die Milch dazu gibt es auch. Klassischen indischen Tschai aber bekomme ich nur auf Nachfrage. Das Essen mit den Händen scheint auch nicht wirklich vorgesehen. Besteck liegt bereit, Fingerschalen kommen nicht.
Aber fuhr ich wirklich nach Indien? Als mich der Kollege nachts in das
Hotel brachte, fragte ich mich das ernsthaft. Es war auf jeden Fall nicht das Indien, das ich von meiner Familie her kannte. Dafür ist das Imperial viel zu sauber, funktionstüchtig und wahrlich „imperial“. An allen Wänden hängen britische Lithografien mit heldenhaften Soldaten und exotischen Eingeborenen. Die Kellner tragen Fantasieuniformen. Das Frühstücksbuffet bietet English Breakfast mit allem drum und dran und auch ein paar kalte Paranthas und Pickles. Schwarzer Tee wird ständig nachgeschenkt, die Milch dazu gibt es auch. Klassischen indischen Tschai aber bekomme ich nur auf Nachfrage. Das Essen mit den Händen scheint auch nicht wirklich vorgesehen. Besteck liegt bereit, Fingerschalen kommen nicht.
Schon beim Frühstück kann man genau erkennen, wer von wo kommt. Meine deutschen Kollegen aus der Region freuen sich auf europäisches Essen. Der Kollege aus Islamabad labt sich an Speck. Man merkt ihm den montatelangen Schweinefleischentzug an. Nur ich bestehe drauf, in Indien indisch zu essen. Im Laufe der Woche lege ich diese Arroganz etwas ab. Natürlich können wir auch Italienisch essen gehen. Bei meinem anschliessenden Familienbesuch werde ich sicher authentisch und ausschliesslich indisch essen. Meine Verwandten bestehen schliesslich selbst bei ihren Besuchen in Deutschland auf indischem Essen. Da ist der Vertreter einer deutschen Bank, mit dem wir zu Mittag essen, schon viel anpassungswilliger. Er bestellt wie ich ein Thali. Ich passe mich auch lieber an und verzichte in dieser deutschen Runde darauf, mit den Händen zu essen. Mit meinem indischen Namen und gekleidet in Salwar Kamiz muss ich ohnedies schon explizit darauf hinweisen, dass ich die Besucherin aus Deutschland bin.
 Tagen lässt es sich hervorragend im Hotel. Wir haben ein eigenes Sitzungszimmer. Es ist gut klimatisiert. Wir haben Ruhe. Auch die Computerpräsentation läuft reibungslos. Wir kommen gut voran mit unserer Arbeit. Das wir in Indien sind, merken wir nur, wenn wir zum Mittagessen auf der Wiese in der Sonne sitzen.
Tagen lässt es sich hervorragend im Hotel. Wir haben ein eigenes Sitzungszimmer. Es ist gut klimatisiert. Wir haben Ruhe. Auch die Computerpräsentation läuft reibungslos. Wir kommen gut voran mit unserer Arbeit. Das wir in Indien sind, merken wir nur, wenn wir zum Mittagessen auf der Wiese in der Sonne sitzen.
Verlassen wir den Hotelkomplex, um etwa ins Büro zu fahren, bleibt Indien weiter überraschend fern. Ich bin noch die Ambassadors gewohnt, erinnere mich daran wie ich mir als Kind den Kopf an den Gardinenaufhängungen blutig geschlagen habe, wenn ich während der Fahrt auf und ab geschleudert wurde. Das war mein Indien. Heute aber gleiten wir im Dienstwagen geräuschlos, gut gefedert und klimatisiert dahin. Kaum noch sind Ambassadors zu sehen und auch die Marutis sind weniger geworden. Die Strassen sind voll von einem bunten Gemisch westlich geprägter Autos. Als ich am Wochenende mit meinem Neffen – dem Mann der Tochter meiner Cousine – durch Delhi fahre, zückt er zu meiner Irritation einen Stadtplan, um sich zu orientieren, und hält dafür sogar am Straßenrand an. Erst bei einer Auto-Rikscha-Fahrt durch Alt-Delhi bekomme ich dann das indische Feeling meiner Erinnerung.
Im Hotelzimmer schalte ich den Fernseher an. BBC World Service zeigt mir Indien. In Godhra sind Hindus bei einem Anschlag auf einen Zug mit Kar Sevaks umgekommen. In den folgenden Tagen kommen Hunderte Muslime bei Ausschreitungen um. Schuld sind der pakistanische Geheimdienst und die indischen Muslime selbst. So die Einschätzung nicht weniger Medien, hoher Entscheidungsträger und auch einiger meiner Verwandten. Einer, der früher in Deutschland gelebt hat, freut sich, dass ich bei der Stiftung arbeite. Die ihr nahestehende Partei sei doch so ähnlich wie die BJP. Meinen heftigen Protest versteht er nicht. Wenn ich die Religion beiseite lasse, blieben doch die gleichen sozialen Anliegen.
 Zur Ablenkung schalte ich auf MTV um. Ich will Bollywoodmusik hören und zusehen, wie dabei dezent angedeutet wird. Aber nichts ist. Da neigen sich keine Blümchen zueinander, flattern Schmetterlinge oder werden Heldinnen aus heiterem Himmel von Regenschauern heimgesucht. Nein, es geht richtig zur Sache. Der Held und die Heldin umtanzen, umfassen und ... küssen sich. Immer wieder. Ganz anders als ich es in Deutschland immer erzähle.
Zur Ablenkung schalte ich auf MTV um. Ich will Bollywoodmusik hören und zusehen, wie dabei dezent angedeutet wird. Aber nichts ist. Da neigen sich keine Blümchen zueinander, flattern Schmetterlinge oder werden Heldinnen aus heiterem Himmel von Regenschauern heimgesucht. Nein, es geht richtig zur Sache. Der Held und die Heldin umtanzen, umfassen und ... küssen sich. Immer wieder. Ganz anders als ich es in Deutschland immer erzähle.
 Die Dienstreise ist beendet und ich habe noch ein paar Tage Urlaub. Die verbringe ich bei der Familie – in vertrauter Umgebung. Die Wohnung ist dunkel wie immer. Die Sonne soll bloss draussen bleiben. Der Schmutz an den Wänden ist auch wie immer. Aus der Toilette riecht es vertraut. Eine neue Kloschüssel, aber kein Papier. So weit so bekannt. Aber dann die Überraschung. Das Vorratsszimmer ist in einen Büroraum umgewandelt. Dort stehen zwei Computer. Ich kann meine emails abrufen. Meine Familie ist online.
Die Dienstreise ist beendet und ich habe noch ein paar Tage Urlaub. Die verbringe ich bei der Familie – in vertrauter Umgebung. Die Wohnung ist dunkel wie immer. Die Sonne soll bloss draussen bleiben. Der Schmutz an den Wänden ist auch wie immer. Aus der Toilette riecht es vertraut. Eine neue Kloschüssel, aber kein Papier. So weit so bekannt. Aber dann die Überraschung. Das Vorratsszimmer ist in einen Büroraum umgewandelt. Dort stehen zwei Computer. Ich kann meine emails abrufen. Meine Familie ist online.
Nicht virtuell, nein ganz praktisch sollen sie nun meine Heimat kennenlernen. Ich packe Schwarzbrot und Nutella, Tagliattelle und Olivenöl sowie Puddingpulver aus. Meine Verwandten sind misstrauisch, ob auch wirklich alles vegetarisch ist. Sie probieren aber trotzdem. Pasta mit Tomatensauce scheint ok, mein Schwager braucht nur mehr Pfeffer. Der Schokoladenpudding ist zwar nicht süss genug, aber eine zweite Portion darf es trotzdem sein. Das Nutella findet willige Abnehmer. Nur das Brot bleibt im Kühlschrank.
 Und das Konzept arranged marriage bleibt auch. Die zweite Tochter ist gerade verheiratet worden und erwartet ihren ersten Sohn – vielleicht wird es auch ein Mädchen. Die dritte macht noch ihren Masters, aber nächstes Jahr ist sie dann auch so weit.
Und das Konzept arranged marriage bleibt auch. Die zweite Tochter ist gerade verheiratet worden und erwartet ihren ersten Sohn – vielleicht wird es auch ein Mädchen. Die dritte macht noch ihren Masters, aber nächstes Jahr ist sie dann auch so weit.
Einiges bleibt doch wie es war, zumindest ein bisschen.
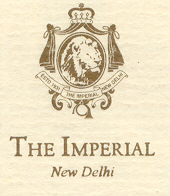 Aber fuhr ich wirklich nach Indien? Als mich der Kollege nachts in das
Hotel brachte, fragte ich mich das ernsthaft. Es war auf jeden Fall nicht das Indien, das ich von meiner Familie her kannte. Dafür ist das Imperial viel zu sauber, funktionstüchtig und wahrlich „imperial“. An allen Wänden hängen britische Lithografien mit heldenhaften Soldaten und exotischen Eingeborenen. Die Kellner tragen Fantasieuniformen. Das Frühstücksbuffet bietet English Breakfast mit allem drum und dran und auch ein paar kalte Paranthas und Pickles. Schwarzer Tee wird ständig nachgeschenkt, die Milch dazu gibt es auch. Klassischen indischen Tschai aber bekomme ich nur auf Nachfrage. Das Essen mit den Händen scheint auch nicht wirklich vorgesehen. Besteck liegt bereit, Fingerschalen kommen nicht.
Aber fuhr ich wirklich nach Indien? Als mich der Kollege nachts in das
Hotel brachte, fragte ich mich das ernsthaft. Es war auf jeden Fall nicht das Indien, das ich von meiner Familie her kannte. Dafür ist das Imperial viel zu sauber, funktionstüchtig und wahrlich „imperial“. An allen Wänden hängen britische Lithografien mit heldenhaften Soldaten und exotischen Eingeborenen. Die Kellner tragen Fantasieuniformen. Das Frühstücksbuffet bietet English Breakfast mit allem drum und dran und auch ein paar kalte Paranthas und Pickles. Schwarzer Tee wird ständig nachgeschenkt, die Milch dazu gibt es auch. Klassischen indischen Tschai aber bekomme ich nur auf Nachfrage. Das Essen mit den Händen scheint auch nicht wirklich vorgesehen. Besteck liegt bereit, Fingerschalen kommen nicht.
 Tagen lässt es sich hervorragend im Hotel. Wir haben ein eigenes Sitzungszimmer. Es ist gut klimatisiert. Wir haben Ruhe. Auch die Computerpräsentation läuft reibungslos. Wir kommen gut voran mit unserer Arbeit. Das wir in Indien sind, merken wir nur, wenn wir zum Mittagessen auf der Wiese in der Sonne sitzen.
Tagen lässt es sich hervorragend im Hotel. Wir haben ein eigenes Sitzungszimmer. Es ist gut klimatisiert. Wir haben Ruhe. Auch die Computerpräsentation läuft reibungslos. Wir kommen gut voran mit unserer Arbeit. Das wir in Indien sind, merken wir nur, wenn wir zum Mittagessen auf der Wiese in der Sonne sitzen.
 Zur Ablenkung schalte ich auf MTV um. Ich will Bollywoodmusik hören und zusehen, wie dabei dezent angedeutet wird. Aber nichts ist. Da neigen sich keine Blümchen zueinander, flattern Schmetterlinge oder werden Heldinnen aus heiterem Himmel von Regenschauern heimgesucht. Nein, es geht richtig zur Sache. Der Held und die Heldin umtanzen, umfassen und ... küssen sich. Immer wieder. Ganz anders als ich es in Deutschland immer erzähle.
Zur Ablenkung schalte ich auf MTV um. Ich will Bollywoodmusik hören und zusehen, wie dabei dezent angedeutet wird. Aber nichts ist. Da neigen sich keine Blümchen zueinander, flattern Schmetterlinge oder werden Heldinnen aus heiterem Himmel von Regenschauern heimgesucht. Nein, es geht richtig zur Sache. Der Held und die Heldin umtanzen, umfassen und ... küssen sich. Immer wieder. Ganz anders als ich es in Deutschland immer erzähle.
 Die Dienstreise ist beendet und ich habe noch ein paar Tage Urlaub. Die verbringe ich bei der Familie – in vertrauter Umgebung. Die Wohnung ist dunkel wie immer. Die Sonne soll bloss draussen bleiben. Der Schmutz an den Wänden ist auch wie immer. Aus der Toilette riecht es vertraut. Eine neue Kloschüssel, aber kein Papier. So weit so bekannt. Aber dann die Überraschung. Das Vorratsszimmer ist in einen Büroraum umgewandelt. Dort stehen zwei Computer. Ich kann meine emails abrufen. Meine Familie ist online.
Die Dienstreise ist beendet und ich habe noch ein paar Tage Urlaub. Die verbringe ich bei der Familie – in vertrauter Umgebung. Die Wohnung ist dunkel wie immer. Die Sonne soll bloss draussen bleiben. Der Schmutz an den Wänden ist auch wie immer. Aus der Toilette riecht es vertraut. Eine neue Kloschüssel, aber kein Papier. So weit so bekannt. Aber dann die Überraschung. Das Vorratsszimmer ist in einen Büroraum umgewandelt. Dort stehen zwei Computer. Ich kann meine emails abrufen. Meine Familie ist online.
 Und das Konzept arranged marriage bleibt auch. Die zweite Tochter ist gerade verheiratet worden und erwartet ihren ersten Sohn – vielleicht wird es auch ein Mädchen. Die dritte macht noch ihren Masters, aber nächstes Jahr ist sie dann auch so weit.
Und das Konzept arranged marriage bleibt auch. Die zweite Tochter ist gerade verheiratet worden und erwartet ihren ersten Sohn – vielleicht wird es auch ein Mädchen. Die dritte macht noch ihren Masters, aber nächstes Jahr ist sie dann auch so weit.